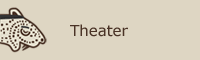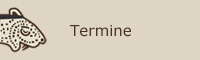Presse
© Welt | Axel Springer SE 2014. Alle Rechte vorbehalten
HAMBURG | Artikel vom 31.03.2013 / Ausgabe 13 / Seite 9 /
Günter Fink
http://www.welt.de/print/wams/hamburg/article114899094/Man-wird-nicht-Musiker-man-ist-es.html
"Man wird nicht Musiker, man ist es"
Johannes Huth ist ein vielseitiger Künstler: Er spielt Kontrabass, leitet das Jourist Quartett, geht mit dem Glenn-Miller-Orchestra auf Tournee und unterrichtet an der Musikhochschule
Er ist häufig der Mann im Hintergrund. Doch der Kontrabassist, Arrangeur, Komponist und Produzent Johannes Huth, 45, arbeitet schon lange mit prominenten Künstlern wie Ulrich Tukur, Marie Bäumer und Dominique Horwitz zusammen. Mit den Kammermusikern des Jourist Quartetts hat er das CD-Album "8 Tango Seasons" aufgenommen. Ein Gespräch über Minusgeschäfte, Energiekurven und den Traum, auf der Bühne zu sterben
Welt am Sonntag:
Herr Huth, es heißt, Sie haben eine besondere Affinität zu Russland. Wieso?
Johannes Huth:
Es hat auf jeden Fall viel mit meiner Seele zu tun. Ich habe tatsächlich eine starke Affinität zu Russland, weil ich 1998 angefangen habe, mit dem in der Ukraine geborenen Efim Jourist, dem Namensgeber des Quartetts, zusammen zu arbeiten. Ich mochte ihn sehr. Er war für mich ein sehr guter Freund und mein musikalischer Mentor. Ich habe von ihm irrsinnig viel gelernt: musikalisch zu arbeiten, zu proben, durchzuhalten und sich zu konzentrieren. Seine harte Moskauer Schule hat mich bis heute geprägt.
Neben den Auftritten mit dem Quartett gehen Sie regelmäßig mit dem Glenn-Miller-Orchestra auf Jazz-Tournee?
Genau. Im November geht es wieder los - nach Russland.
Wenn man so vielseitig ist, worauf kommt es in Ihrem Beruf an?
Man muss als Musiker schnellstmöglich lernen, sich von Kritik nicht persönlich angesprochen zu fühlen. Es geht immer nur um die Sache, um die Musik. Und man muss lernen, Dinge aus dem Alltag, die einen eventuell umtreiben, auf der Bühne oder beim Spielen auszuschalten und auszublenden. Man muss auf die Bühne gehen und ist dann nur für die Musik da. Das betrifft auch instrumentale, schwierige Stellen. Das Publikum interessiert es nicht, ob es eine besonders schwierige Stelle ist oder nicht. Es soll alles leicht sein und flüssig klingen.
Warum haben Sie sich für den Kontrabass entschieden? Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein schweres Instrument ...
Ich habe zwar einen Kombi, aber ich muss meinen Kontrabass auch häufig durch die Gegend tragen. Das härteste ist, ihn zu Hause noch in den 4. Stock in meine Altbauwohnung in Eimsbüttel zu schleppen. Es gibt keinen Fahrstuhl.
Sie brauchen kein Fitnesstraining?
Das nicht. Aber ich boxe seit einem halben Jahr. Vorher habe ich zehn Jahre Kampfsport gemacht. Körperlicher Ausgleich ist für mich wichtig, denn ich stehe ja am Kontrabass, und musizieren ist eine athletische Angelegenheit. Aber man steht eben und bewegt sich kaum. Die muskuläre Verspannung, die dann entsteht, die muss man lösen. Deswegen mache ich sehr gern Ausdauersport.
Angenommen Sie würden Kultursenatorin Barbara Kisseler gegenübersitzen, was hätten Sie ihr zu sagen?
Ich würde ihr gern sagen, dass sie und damit der Senat darauf achten muss, dass die Subkultur erhalten bleibt und gefördert werden muss. Weil wir alle wissen, und das ist keine neue Erkenntnis, Kultur entsteht aus der Subkultur. Das heißt, kleine Clubs, egal ob Birdland, Bar 227, das Live in Eimsbüttel oder das Knust, ganz egal in welchem Genre wir uns befinden, es ist wichtig, dass diese Szene funktioniert.
Ein altbekanntes Klagelied ...
Und das völlig zu Recht. Wo sonst, wenn nicht in diesen Läden, können Musiker ihre ersten Versuche machen? Egal, ob das jetzt Klassik ist, Jazz oder Rock oder Pop. Ich beobachte mit großer Sorge, dass in den vergangenen Jahren die Geldtöpfe immer mehr zusammengefasst und verkleinert werden.
Und das im Schatten der Millionen verschlingenden Elbphilharmonie!
Ich oute mich gern: Mit der Elbphilharmonie habe ich kein Problem. Ich glaube, wann immer das Ding eröffnet wird, hat man nach ein paar Jahren alles vergessen. Die Menschen werden hingehen und es toll finden, sich wunderbare Konzerte anhören zu können. Letztlich ist es doch so, dass neuer Raum für Musik geschaffen wird. Das ist für mich der wichtige Punkt, und darüber würde ich mit Frau Kisseler gern sprechen. Damit die enorme Summe, die an Steuern aufzubringen ist, nicht zu Lasten der Förderung der kleinen Clubs geht.
Wird der Beruf des Musikers angesichts der technischen Entwicklungen irgendwann überflüssig?
Man wird nicht Musiker, man ist es. Ich habe mit vielen jungen Leuten an der Hochschule zu tun. Natürlich hoffen die alle, irgendwo unterzukommen.
Und landen auf dem Arbeitsamt ...
Oder als Musiklehrer in einer privaten Musikschule. Das ist es dann schon. Aber ich bin davon überzeugt, wenn man für den Beruf des Musikers brennt, dann macht man auch seinen Weg. Zugegeben ein kurviger Weg, mit Auf und Ab wie Ebbe und Flut.
Macht der Beruf, umgeben von diesen Problematiken, noch Spaß?
In mir gibt es eine kleine Maschine, die mich ständig antreibt - ob bei Chanson-Abenden gemeinsam mit meiner Frau ...
... der Mezzosopranistin und Liedermacherin Julia Schilinski ...
... oder beim Jazz oder experimenteller Musik, ich nenne das ein Minusgeschäft. Wenn man eine kleine Tour hat, bleibt wirklich nichts übrig. Ich spiele auch gern abends für 20 Euro. Das reicht gerade mal fürs Essen. Das ist die Realität in der heutigen Musikwelt, und nehmen Sie nur die Jazz-Musik. Dort spielen hervorragende Musiker
Als Musiker ist man also entweder oben oder unten?
Nein. Ich sehe mich in der Mitte. Womit aber nicht Durchschnitt gemeint ist.
Haben Sie Existenzsorgen?
Um ganz ehrlich zu sein, es gibt Phasen, in denen ich morgens mit den finanziellen Sorgen aufwache und abends mit ihnen ins Bett gehe. Und wenn dann noch die Steuer kommt, dann bleibt häufig nichts übrig. Das erstaunt mich immer wieder, weil ich wirklich viel arbeite.
Sie haben als musikalischer Leiter mit Schauspielern wie Dominique Horwitz, Marie Bäumer und Ulrich Tukur zusammengearbeitet ...
Und aktuell arbeite ich an einer DVD mit dem Chansonprogramm meiner Frau, mein Jazz-Trio wird auf CD erscheinen, die nächste Tour des Jourist Quartetts muss geplant werden, und es wird eine neue Hörspielproduktion geben.
Sind Sie ein Musik-Workaholic?
Manchmal ist es tatsächlich sehr viel Arbeit. Aber ich habe so etwas wie meine Energiekurve. Dann weiß ich, dass ich die nächsten drei Wochen zu tun habe und dann vier Tage frei. Diese freien Tage sind mir heilig, so dass ich mich nach harter Arbeit wirklich erholen kann.
Diese Kurve kriegen Sie immer hin?
Natürlich nicht.
Ist für Sie ein Leben ohne Musik denkbar? Beispielsweise als Rentner?
Als Musiker kann man nicht in Rente gehen, das geht nicht. Dann lieber ein Ende wie das von Ray Brown, einem der besten Jazz-Bassisten auf dem Planeten. Der starb 2002 mit Mitte 70 während einer US-Tournee. Das ist doch das Tollste überhaupt, dass ich sagen kann: solange ich diesen Bass halten kann, werde ich auch spielen.
© Axel Springer SE 2014. Alle Rechte vorbehalten